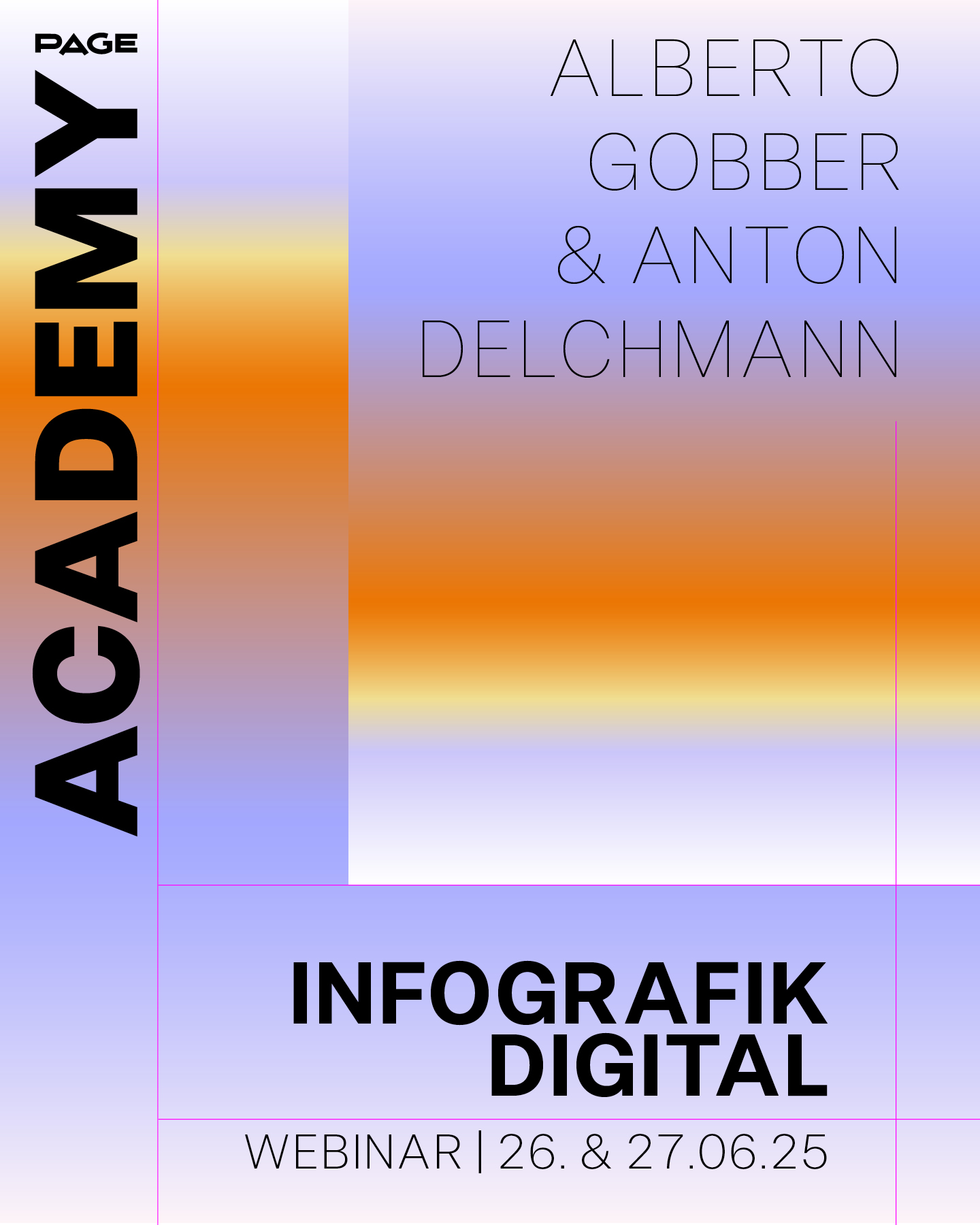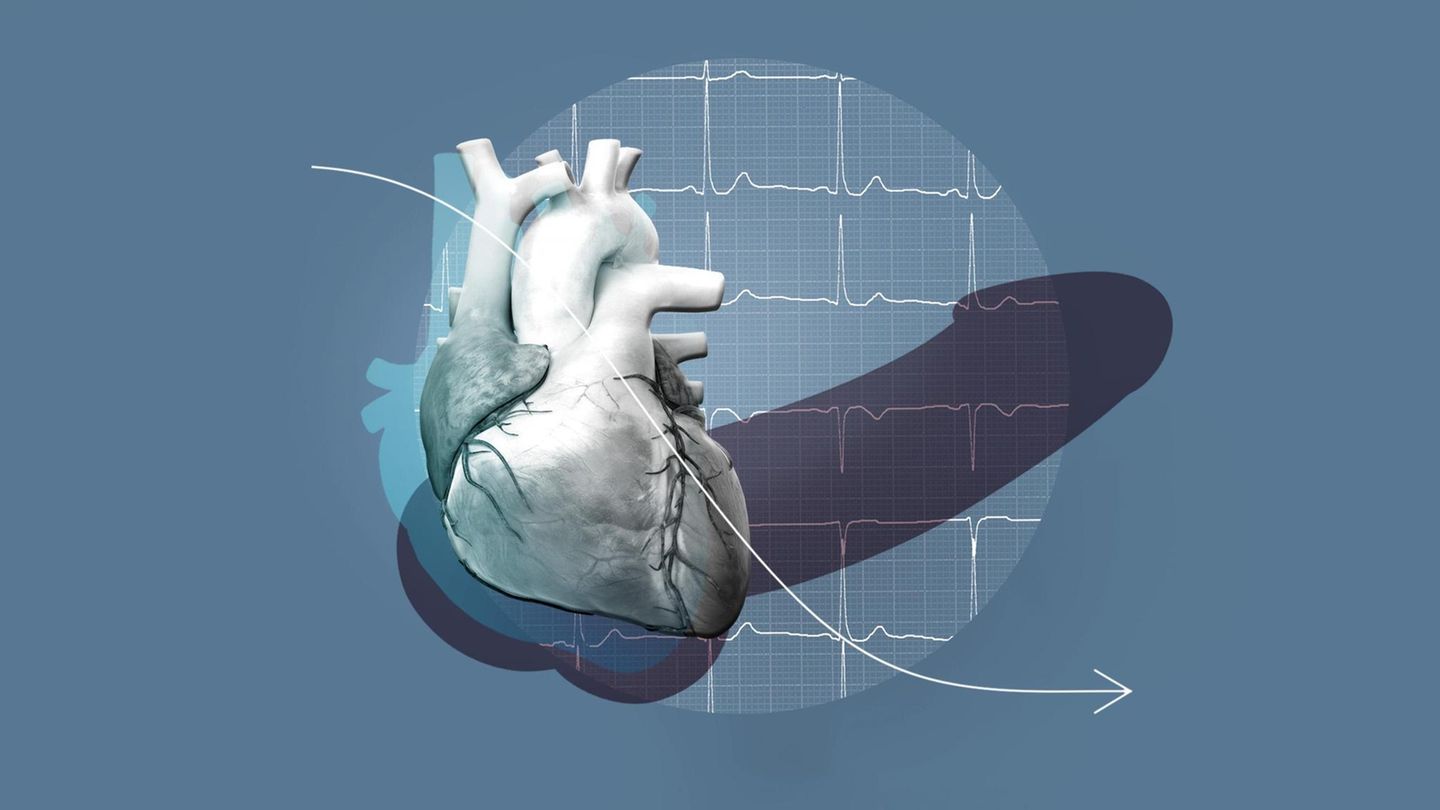Schwarz-Rot: Deutschland bekommt die Koalition, die es verdient
Der Koalitionsvertrag ist wenig ambitioniert – was aber nicht verwundert, angesichts der Wahlprogramme von Union und SPD. Gut möglich, dass die Wirklichkeit das Dokument aber ohnehin bald überholt

Der Koalitionsvertrag ist wenig ambitioniert – was aber nicht verwundert, angesichts der Wahlprogramme von Union und SPD. Gut möglich, dass die Wirklichkeit das Dokument aber ohnehin bald überholt
Zugegeben, es ist schwer, uns Journalisten immer alles recht zu machen. Erst schimpfen wir über den lieben langen Winter, die meisten Wünsche und Forderungen aus den Wahlprogrammen der Parteien seien doch alle unerfüllbar und realitätsfern. Dann beharren wir – nach der Wahl – darauf, dass mit diesem Ergebnis nun aber unbedingt Reformen hermüssten (vor allem solche, die zuvor entweder als realitätsfern galten oder im Wahlkampf von niemandem gefordert wurden). Und jetzt, da der Koalitionsvertrag von Union und SPD vorliegt, stellen wir fest, dass diese ziemlich kleine große Koalition eine herbe Enttäuschung ist und das ganze Regierungsprogramm für die nächsten vier Jahr ganz schön unambitioniert daherkommt.
Nun wurde schon viel geschrieben, analysiert und gemeint über die Pläne und Vorhaben der kommenden Regierung für die nächsten vier Jahre. Immerhin 146 ausladende Seiten, die bisweilen erschlagend detailliert und dann wieder erstaunlich luftig daherkommen. Daher seien diese selbstkritischen Zeilen vorweggeschickt: Wie man diesen Koalitionsvertrag bewertet, ist vor allem eine Frage der eigenen Maßstäbe. Und hier kann man es sich einfach machen und bei dem bleiben, was man schon immer gefordert und für richtig gehalten hat – weitgehend unabhängig vom Wahlergebnis und den Mehrheitsverhältnissen. Oder man stellt zumindest in Rechnung, dass CDU, CSU und SPD jeweils eine bestimmte Programmatik in die Verhandlungen mitbrachten und daraus Kompromisse aushandeln mussten.
Statt eines einfachen Kommentars würde ich mich daher lieber mit fünf Thesen zur kommenden Regierung bescheiden.
#1 Das Land bekommt die Koalition, die es verdient
Man kann jetzt zu Recht beklagen, Union und SPD nähmen sich zu wenig vor und blieben zurück hinter den objektiven Notwendigkeiten. Das gilt etwa für den ganzen Bereich der Gesundheits-, Pflege- und Rentenpolitik. Hier will die Koalition eigentlich nur den Status quo verwalten – auch wenn der designierte Kanzler Friedrich Merz behauptet, die Koalition plane durchaus eine Rentenreform, wolle dazu aber das Votum einer Expertenkommission abwarten (der wievielten eigentlich?).
Nein, wenn die Ziele einer solchen Reform nicht im Koalitionsvertrag stehen, dann wird auch keine Kommission diese Lücke schließen.
Es stimmt, dass dieser Vertrag wichtige Aufgaben, die sich aus der Alterung der Gesellschaft ergeben, gar nicht adressiert: die dramatischen Ausgabenzuwächse in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung zum Beispiel. Oder die wachsende Lücke in der privaten Altersvorsorge, weil Deutschland es nicht schafft, die gescheiterte Riester-Rente endlich zu reformieren. Hier gab es sogar einen fertigen Gesetzentwurf der geplatzten Ampel-Koalition – die Einführung eines steuerfreien Vorsorgekontos für den privaten Vermögensaufbau im Alter. Es war der womöglich beste und konkreteste Beitrag der Liberalen in der vergangenen Regierungskoalition, auf den ihre Nachfolger einfach hätten zurückgreifen können. Aber nicht mal dazu konnte sich die neue Koalition durchringen. Das ist deprimierend.
Aber der Fairness halber muss man eben festhalten: Weder Union noch SPD hatten sich im Wahlkampf für eine ambitionierte Reformagenda im Sozialbereich starkgemacht. Auch wenn sich alle Experten und Ökonomen einig sind – für eine solche Agenda sind sie auch nicht gewählt worden.
#2 Wirkliche Ambition gibt es nur an einer Stelle
Dort, wo der Koalitionsvertrag große Veränderungen verspricht, sollte man besser zweimal nachlesen. Etwa bei dem vielzitierten Satz „Wir werden das Heizungsgesetz abschaffen.“ Denn es gibt gar kein „Heizungsgesetz“. Was es jedoch gibt, ist das Gebäudeenergiegesetz, und das soll ausdrücklich bleiben. Es war einst von einem CDU-Wirtschaftsminister eingeführt und dann von dessen grünem Nachfolger in den Augen der Union und vieler Hausbesitzer über Gebühr verschärft worden. Nun soll es an manchen Stellen wieder entschärft werden – wo und wie genau, ist aber unklar. Die umstrittene steuerliche Förderung der Wärmepumpe soll aber fortbestehen.
Ähnlich verhält es sich beim Bürgergeld, dessen Abschaffung die Union ebenfalls durchgesetzt haben will. Es stimmt wohl, dass der Name verschwinden wird, ansonsten ändert sich an der künftigen Grundsicherung aber nicht viel. So setzt auch diese große Koalition die Tradition fort, Reformpolitik vor allem als Autosuggestion zu betreiben – sie findet statt, wenn man selbst nur fest genug daran glaubt.
Es gibt aber einen Hoffnungswert in diesem Vertrag, der Anerkennung verdient: Das sind die Pläne zum Abbau von Bürokratie. Hier nimmt sich die Koalition tatsächlich überraschend viel vor – etwa bei der Zusammenführung unterschiedlicher staatlicher Sozialleistungen oder bei den Voraussetzungen für eine Unternehmensgründung. Bezeichnenderweise schöpften Union und SPD hier nicht aus dem Fundus eigener Ideen – den gab und gibt es nämlich nicht –, sondern bedienten sich bei jener kleinen Arbeitsgruppe, die unmittelbar vor Beginn der Koalitionsverhandlungen ihre Vorschläge vorgelegt hatte. Man hätte sich diese Offenheit für externen Rat und vorhandene Vorschläge auch im Sozialbereich gewünscht.
#3 Die Hoffnung heißt Wachstum – es ist zugleich die größte Schwäche
Der Haupttreiber der kommenden Koalition ist die Hoffnung auf mehr Wachstum. Dieses Jahr wird noch einmal ein Stagnations- oder Rezessionsjahr, das ist klar und abgeschrieben aufgrund von Donald Trumps wildem Zoll- und Handelskrieg. 2026 soll dann aber die Wirtschaft anziehen; die Superabschreibungen für Unternehmen sollen wirken genauso wie vielleicht auch schon die ersten zusätzlichen Milliarden für Verteidigung und die Sanierung der Infrastruktur. Um 1,3 Prozent könnte die Wirtschaftsleistung 2026 wachsen, manche Experten rechnen sogar noch mit etwas mehr. Es wäre tatsächlich der höchste Zuwachs seit dann fünf Jahren.
Angesichts der vielen Milliarden, die sich Bund und Länder mit dem hektischen Umbau der Schuldenbremse im Grundgesetz Ende März zusätzlich genehmigt haben, müsste es auch katastrophal schlecht laufen, wenn es nicht so kommt. Immerhin sollten allein die 500 Milliarden für Investitionen und Infrastruktur, die nun über zwölf Jahre bereitstehen, pro Jahr für einen Impuls in Höhe von fast einem Prozent des Bruttoinlandsprodukts sorgen. So gesehen fällt die Wachstumsprognose von 1,3 Prozent sogar eher schwach aus – und sie signalisiert, dass dem Koalitionsvertrag eben doch etwas Entscheidendes fehlt: eine klare Agenda, wie diese Koalition das zusätzliche Geld sinnvoll ausgeben und durch private Investitionen sogar hebeln will.
#4 Wer so schwach startet, kann nur positiv überraschen
Es gibt in diesem Koalitionsvertrag kein Pathos, keine großen Versprechen, nicht mal den Versuch, einen Willen zu großem Fortschritt zu simulieren. Für einen kommenden Kanzler Friedrich Merz, der einst als innerparteilicher Oppositionsführer gegen die Trippelschritte der amtierenden CDU-Kanzlerin Angela Merkel ätzte, ist das eine erstaunliche Verwandlung, ja, eine Merkelisierung geradezu. Man kann das kritisieren, aber wahrscheinlich ist es auch ganz ehrlich: Weder ist Merz der knallharte Disruptor, als der er selbst gerne auftrat, noch ist diese Methode in Deutschland mehrheitsfähig und realistisch.
Bei allen Versäumnissen der Ära Merkel hat doch eine große Mehrheit in der Bevölkerung immer noch das Gefühl, die 16 Jahre unter Merkel seien insgesamt gute Jahre gewesen. Und zum Erfolgsgeheimnis von Merkel gehörte eben auch, sich lieber nicht allzu viel vorzunehmen, um dann ja nicht an den eigenen Ambitionen scheitern zu können. Zumal sich – auch das war eine Erkenntnis der Ära Merkel – meist bald nach Regierungsantritt in Berlin die Weltlage so schnell änderte, dass plötzlich ganz andere Aufgaben auf der Tagesordnung standen. Es spricht viel dafür, dass es auch dieser Regierung so ergehen wird – umso mehr aber hätte man sich gleich zu Beginn der Amtszeit eben doch eine klarere und beherztere Reformagenda gewünscht.
#5 Die eigentlichen Aufgaben liegen in Brüssel
Wenn man Friedrich Merz eines zutrauen darf, dann ist es ein stärkerer Wille, mit Frankreich, Polen oder Italien zu europäischen Lösungen zu kommen. Merz ist überzeugter Europäer, er sieht sich – anders vielleicht als seine Vorgänger Merkel und Scholz – in einer Linie mit Helmut Kohl. Während Merkel und Scholz in den vergangenen 20 Jahren stets peinlich genau darauf achteten, die deutschen Interessen bis hin zur Größe und Beschaffenheit eines Schaltknüppels in einem möglichen europäischen Kampfflugzeug zu wahren, wird sich Merz mit solchen Details hoffentlich nicht mehr allzu lange aufhalten. Das kann eine Chance sein, erst recht im großen Gerangel der Supermächte USA und China, das bereits im vollen Gange ist.
Wenn man so will, ist dies das eigentlich Erstaunliche an diesem Koalitionsvertrag: Dass sich CDU, CSU und SPD überhaupt noch die Mühe gemacht haben, auf 146 Seiten bis ins kleinste Detail zusammenzutragen, was ihnen alles wichtig ist – von der Insolvenzsicherung für Pauschalreisen bis zur Förderung mobiler Schwimmcontainer an Orten, wo öffentliche Schwimmbäder fehlen. Man kann das als Vertragsfolklore bezeichnen, sie wirkt auch ein bisschen lächerlich angesichts der dramatischen Aufgaben in der Welt gerade. Aber sie stört auch nicht wirklich, wenn sie nicht ablenkt von den wirklich wichtigen Dingen. Und die werden ohnehin kommen, egal, was jetzt im Koalitionsvertrag steht.







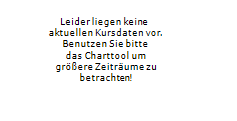










:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/18/e9/18e9a988d3ca7593fb3324e8abc33e56/0124025380v2.jpeg?#)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/24/c4/24c463bcbdd29c1d6b870b676a7c91c1/0123887278v1.jpeg?#)